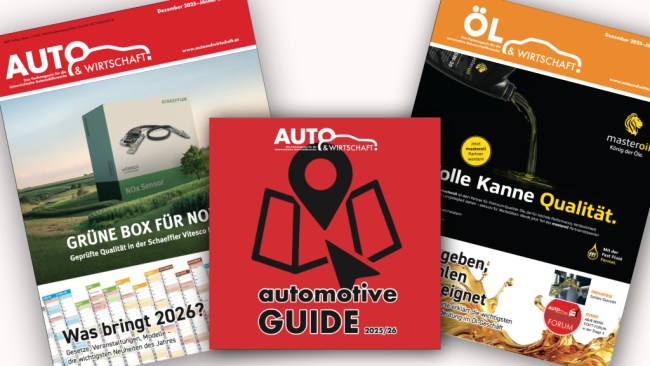„Die Hersteller brauchen uns Händler“
Zwei bis drei Prozent Umsatzrendite müssen im Kfz-(Einzel-)Handel übrigbleiben, betont Komm.-Rat Ing. Klaus Edelsbrunner, Bundesgremialobmann des österreichischen Fahrzeughandels. Die jüngste Branchenerhebung wurde 2013 präsentiert, damals lag die Umsatzrendite im Schnitt gerade einmal bei 0,5 Prozent. An der Situation hat sich seither wenig geändert. „Es gibt viele Einflüsse von außen, die sich auf die Ertragslage der Kfz-Betriebe negativ auswirken“, verweist Edelsbrunner auf die Kostensteigerungen vorrangig bei Energie und Personal in den vergangenen Jahren. Zudem sind die Pkw-Neuzulassungen noch immer weit weg vom 2019er-Niveau – diese Fahrzeuge fehlen im Verkauf und später auch in der Werkstätte. Um gegenwärtig und auch in Zukunft Erträge zu erwirtschaften, rät Edelsbrunner den Firmenverantwortlichen, Schritt für Schritt alle Kosten im Betrieb auf den Prüfstand zu stellen. Das beginnt bei den Ausgaben für Marketingmaßnahmen, geht über Zinssätze und Versicherungen und reicht bis zu IT-Dienstleistungen.
Auf der anderen Seite nimmt Edelsbrunner auch die Fahrzeughersteller bzw. -importeure verstärkt in die Pflicht. „Dass in Zeiten wie diesen immer wieder neue Standards verlangt werden, ist schwierig. Das gehört hinterfragt.“ Das ist aber nur eine Hürde: In jüngster Zeit hat auch der Bürokratieaufwand, der seitens der Hersteller verlangt wird, zugenommen. „Das bindet Personal und lähmt unsere Arbeit“, kritisiert der Branchenvertreter.
Die Ertragssituation ist auch stark vom jeweils zum Einsatz kommenden Vertriebsmodell abhängig. Neben dem traditionellen Händlersystem gibt es auch das Agenturmodell und Sonderformen wie Business Provider oder Subhändler. „Im Mittelpunkt sollte immer die Frage stehen: Wie sehen meine Konditionen aus?“, so Edelsbrunner. Diese Frage muss jeder Betrieb für sich selbst beantworten. Manchmal kann ein Schritt zurück, also der Umstieg auf einen Business Provider oder Subhändler, insgesamt von Vorteil sein. Trotz Konzentration in der Handelslandschaft wirft sich für den Bundesgremialobmann die Frage auf, ob ein Vielmarkenhandel die Zukunft ist. „Die Hersteller müssen aufpassen, dass sie sich da nicht verzetteln.“ Hat man mehr Marken im Angebot, wird man hier nicht alle gleich gut bedienen können. Ungleichgewichte im eigenen Betrieb könnten die Folge sein. Und auch der Internetvertrieb funktioniert noch nicht so, wie manche Hersteller das gerne hätten: „Die Hersteller brauchen uns Händler, und das auch in der Zukunft.“
„Möglichst viele Ertragsbringer im Betrieb halten“
Dass seit dem Einschnitt, den das Covid-Virus und seine Spätfolgen der Branche gebracht haben, pro Jahr Zigtausende Neuwagen pro Jahr fehlen, schadet nicht nur dem Handel, sondern auch den Werkstätten: „Denn die Fahrzeuge, die nicht verkauft wurden, fehlen uns ja im Service“, sagt Bundesinnungsmeister MMst. Roman Keglovits-Ackerer, BA. Hier seien vor allem die Markenwerkstätten betroffen: „Die älteren Fahrzeuge, die jetzt länger gefahren werden, kommen ja selten zu den Markenbetrieben.“ Und dennoch: Werkstätten gelten weiterhin als wichtiger Ertragsbringer in einem Autohaus, wiewohl Keglovits-Ackerer relativiert: „Werkstätten -funktionieren auch nicht ohne den Handel, der den Nachschub liefert.“
Der Niederösterreicher rät den Mitgliedsbetrieben, möglichst viele Ertragsbringer im eigenen Betrieb zu behalten – oder sogar zurückzuholen wie etwa die professionelle Reinigung. Wichtig sei auch, über die Rädereinlagerung Erträge zu erwirtschaften und bei den Wechselterminen auch eine Achsvermessung anzubieten. Ebenso rät er, alle Schritte bei einem Werkstattbesuch zu dokumentieren, und das nicht nur auf einem Zettel. „Zum Beispiel ein Foto vom Unterboden machen, wie er vor und nach einer Behandlung ausgeschaut hat.“ Ebenso rät Keglovits-Ackerer, die Kunden-Ersatzautos nicht kostenlos anzubieten: „In unserem Betrieb verlangen wir 37 Euro pro Tag, dazu kommt auf Wunsch noch eine Zusatzzahlung, um den Selbstbehalt zu reduzieren. Alles andere ist kaufmännischer Totschlag.“
Obwohl Keglovits-Ackerer in seinen Betrieben 20 produktive Mitarbeiter hat, weicht auch er bei manchen Dienstleistungen auf Kollegen aus, wenn die Arbeit zu viel wird: „Ich predige das immer wieder: Wir müssen in der Branche zusammenarbeiten: Man kann nicht alles selbst abdecken, sonst wird es zu teuer.“ Die massive Steigerung der Kosten aus den vergangenen Jahren könne man nur durch mehr Produktivität und Bürokratieabbau im eigenen Betrieb lösen.
Und wie sieht es bei den Mitarbeitern aus? „Es ist nach wie vor schwierig, und die eigene Ausbildung wird immer wichtiger. Da immer mehr Antriebsarten angeboten werden, wird noch einiges auf uns zukommen.“ Die Betriebe müssten auch die Elektromobilität als normalen Antrieb anerkennen: „Auch in diesem Bereich ist viel Arbeit zu tun.“ Und die freien Werkstätten? Sie sollten sich laut Keglovits-Ackerer auf bestimmte Marken konzentrieren: „Wichtig ist ein SERMI-Zugang, damit man auch an die wichtigsten Daten zum Arbeiten kommt.“ Mit viel Zuversicht kann man alles angehen!