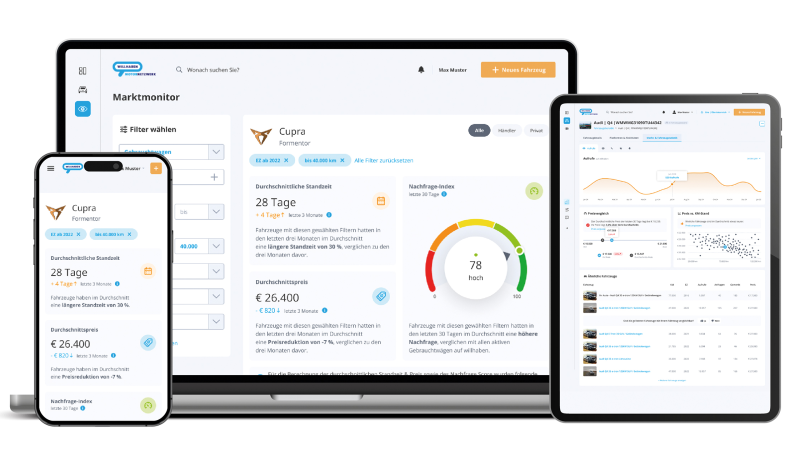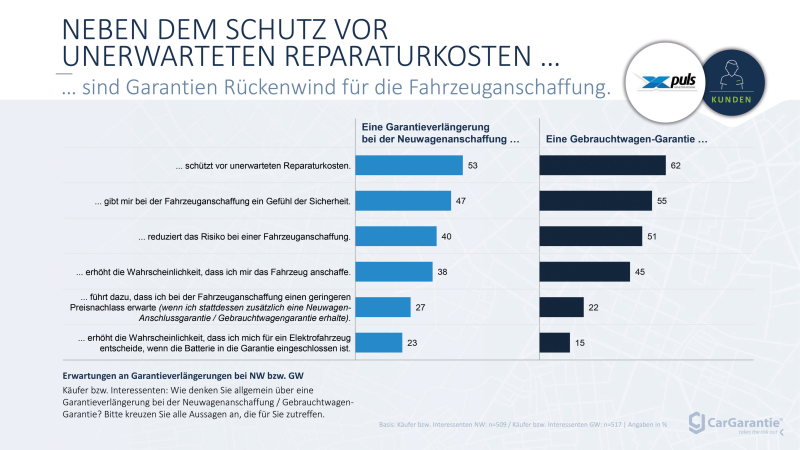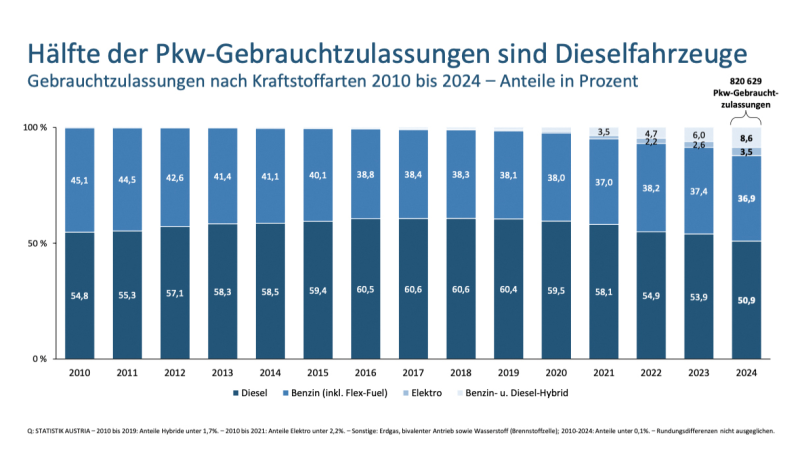Böse Autokraten in Peking und Washington haben den Spieß umgedreht. China exportiert plötzlich seine E-Autos nach Europa, die USA haben den Zollhammer ausgepackt. Und in Europa wackeln die Arbeitsplätze.
Bisher wurden US-Autoimporte mit 10 Prozent Zoll belegt. Umgekehrt waren die europäischen Autos durch den niedrigen US-Zoll (2,5 %) in den USA relativ billig. Insgesamt importierten die USA Autos im Gesamtwert von 210,3 Mrd. Dollar (2023). Davon entfiel der Großteil auf Mexiko (45 Mrd. Dollar), gefolgt von Japan und Korea. Die EU lag 2024 laut International Trade Administration (ITA) vor Kanada auf Platz vier.
Von den 16,1 Millionen Stück des US-Autogesamtmarktes (2024) entfielen nur rund 60 Prozent auf US-Inlandsprodukte. Selbst diese war von einem Teile-Import im Ausmaß von 192 Mrd. Dollar abhängig. Weshalb der geplante Zoll-Hammer auch diese importierten Zulieferungen treffen sollte. Der US-Präsident dekretierte zur Verbesserung der US-Handelsbilanz einen Zoll von 25 Prozent auf alle Auto- und Kfz-Teile-Importe. Nicht nur für -Europa, sondern auch für alle Exportländer wie Japan, Korea, Mexiko und Kanada. So entfielen 2024 etwa 28,3 Prozent aller japanischen US-Exporte auf das Autogeschäft. Koreas Hyundai muss aus dieser Sicht laut „Bloomberg“ mit zusätzlichen Kosten von 7 Mrd. Dollar rechnen, da 50 Prozent der US-Verkäufe auf Import-Modelle entfallen.
Mit einem Durchschnittspreis von 46.000 Euro pro importiertes EU-Auto belastet der neue Zoll die bisher ertragreichen europäischen Premium-Hersteller. Vor allem die deutschen Autokonzerne träfe es hart. So gingen 446.566 Automobile um 24,8 Mrd. Dollar (das sind 13 Prozent aller deutschen Exporte) in die USA. Eines der größten VW-Werke steht in Mexiko, wo die in den USA sehr beliebten Jetta und Tiguan produziert werden. Ähnlich sieht es bei Audi aus. Von den an 16 Standorten produzierten 1,7 Millionen Stück entfallen 175.000 auf die Q5--Produktion im jüngsten Audi-Werk in San José Chiapa, das ebenfalls von den US-Zöllen betroffen wäre. VW hat lediglich eine US-Produktionsbasis: In Tennessee, wo der ID.4 und der VW Atlas produziert werden.
Probleme hat auch BMW. Die Bayern assemblieren in ihrem weltweit größten Werk in Spartanburg (South Carolina) rund 400.000 Stück diverser X-Modelle. Davon verbleibt die Hälfte gleich in den USA. Allerdings wären nun auch für deren Zulieferteile 25 Prozent Zoll fällig. Mercedes assembliert in seinem Werk in Tuscaloosa in Alabama rund 300.000 Stück (2023) der GL-Reihen. Motoren und Getriebe kommen aus Deutschland, alles Übrige von -nordamerikanischen Lieferanten.
Auch Stellantis weiß nicht, wie es mit seinen 16 US-Werken mit 52.000 Mitarbeitern in Michigan, Indiana und Ohio für die Marken Chrysler, Dodge und Jeep weitergehen soll. Vor allem, da ein Teil der 2024 in den USA verkauften 1,3 Millionen Modelle aus EU-Produktion stammen, anderseits aus seinen sieben mexikanischen Produktionen in Saltillo und Toluca mit rund 15.000 Mitarbeitern.
Bleibt es bei den angekündigten Zöllen, würden in den USA sämtliche Autos erheblich teurer. Das kommt bei den Wählern nicht gut an. Daher hat Trump am 10. April die angekündigten Zölle für 90 Tage ausgesetzt. Denn nichts wird so heiß gegessen wie gekocht.